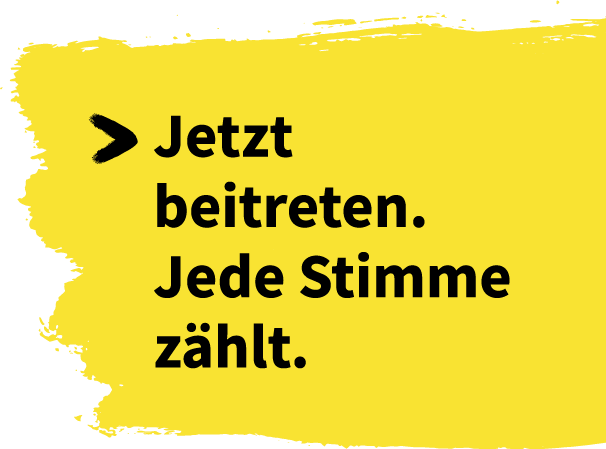Unsere Gesellschaft wird immer älter. Deshalb rückt der Beruf des Altenpflegers zunehmend in die öffentliche Wahrnehmung. Doch wie sieht der Alltag dieser Berufsgruppe tatsächlich aus? Wir haben Pflegerin Gabriele S. einen Tag lang im Altöttinger Seniorenheim St. Klara begleitet. Zwischen wohligen Mittagessen-Ritualen, der Erinnerung an einen Kripo-Besuch und Gänsemärschen durch den Garten zeigt sich die menschliche Seite der Pflege.
Altötting. Die Rollatoren der Bewohnerinnen und Bewohner stehen eng geparkt vor der Fensterfront des Esszimmers im Erdgeschoss: Gleich gibt es Mittagessen im St.-Klara-Heim, doch zuerst muss der Tisch gedeckt werden. Altenpflegerin Gabriele S. erklärt: „Das ist eine Gabel, die brauche ich für das Anstechen von Fleisch. Hier, das ist ein Messer zum Schneiden“ und dann fährt sie fort: „Schauen Sie mal, hier haben wir noch mehr Löffel, genau, Löffel, damit isst man weiche Speisen, zum Beispiel Suppe.“ Die meisten Seniorinnen und Senioren plaudern während des Tischdeckens angeregt miteinander, lachen und freuen sich auf das gemeinsame Mittagessen. Andere, die an Demenz erkrankt sind, müssen sich stark konzentrieren, um Gabriele S. zu folgen.
 Gabriele S. vom Altöttinger Alten- und Pflegeheim St. Klara liebt ihren Beruf. Die ehemalige Unternehmerin ist dort als Altenpflegerin in der sozialen Betreuung tätig. (Foto: Thomas Dashuber/VdPB)
Gabriele S. vom Altöttinger Alten- und Pflegeheim St. Klara liebt ihren Beruf. Die ehemalige Unternehmerin ist dort als Altenpflegerin in der sozialen Betreuung tätig. (Foto: Thomas Dashuber/VdPB)
In den Erdgeschossgruppen des Altöttinger Pflegeheims St. Klara leben 98 Bewohnerinnen und Bewohner unabhängig von ihren Pflegegraden miteinander: Von der älteren Dame, die vor allem Hilfe beim Anziehen und der Medikation braucht, bis hin zum hochbetagten Senior, der nach zwei schweren Schlaganfällen nicht mehr alleine essen und aufstehen kann – in St. Klara wird nicht nach Pflegebedarf getrennt. Vielmehr versuchen die Pflegekräfte, ein schönes Miteinander ohne Beschränkungen zu schaffen und jeden Menschen so miteinzubeziehen, wie er es eben kann. Das gemeinsame Tischdecken zum Beispiel sei wichtig, um den Bewohnerinnen und Bewohnern eine ganz normale Tagesstruktur zu geben: „Man kann so auch demenziellen Veränderungen begegnen, etwa, indem man tagtäglich sagt, wofür das Besteck da ist“, erzählt Gabriele S., die für die soziale Betreuung in St. Klara zuständig ist.
 Gleich gibt’s Mittagessen! Aber vorher muss noch der Tisch gedeckt werden. Was gesunden Menschen ganz leicht fällt, kann für demenzkranke Seniorinnen und Senioren zur unlösbaren Aufgabe werden. Die soziale Betreuung übt mit den Bewohnerinnen und Bewohnern alltägliche Abläufe ein und hilft ihnen, sich jeden Tag wieder zu erinnern. (Foto: Thomas Dashuber/VdPB)
Gleich gibt’s Mittagessen! Aber vorher muss noch der Tisch gedeckt werden. Was gesunden Menschen ganz leicht fällt, kann für demenzkranke Seniorinnen und Senioren zur unlösbaren Aufgabe werden. Die soziale Betreuung übt mit den Bewohnerinnen und Bewohnern alltägliche Abläufe ein und hilft ihnen, sich jeden Tag wieder zu erinnern. (Foto: Thomas Dashuber/VdPB)
Linktipp: Von der Gastronomie in die Altenpflege – lesen Sie hier mehr über Gabriele S.
Als der Tisch gedeckt ist, nimmt Gabriele S., den großen Speiseplan von der gläsernen Durchgangtür neben dem Esszimmer und verliest ihn mit lauter Stimme. Dabei schauspielert sie und hält ihn mit großer Geste wie ein Herold weit von sich weg. „Als Vorspeise gibt es Champignoncremesuppe. Dann haben Sie die Wahl zwischen Hackbraten mit Nudeln oder Kartoffelschupfnudeln mit Gemüserahmsoße und Salat.“ Die Gemüserahmsoße entlockt den Bewohnerinnen und Bewohnern ein lautes, zustimmendes „Mmmmmhhhhh“, die Himbeercreme zur Nachspeise ein noch lauteres „Aaahhhhhhh“ und ein kurzes Lied. Einige der älteren Menschen können nicht mehr selbst zum Essen kommen, ihnen stellt Gabriele S. die Auswahl auch nochmal einzeln in ihren Zimmern vor. Kurz darauf werden die Servierwagen hereingerollt – und zwar mit großen Schüsseln, aus denen serviert wird, in St. Klara gibt es kein Essen vom Tablett. „Das ist uns sehr wichtig. Die Menschen sollen sich hier zu Hause fühlen, wie in einer großen Familie“, erklärt die ehemalige Wirtin, die weiß, wie wohlfühlen geht.
Gemeinsames Essen im Rahmen eines therapeutischen Mittagstischs fördert die Kontakte zwischen den Bewohnerinnen und Bewohnern und trainiert das Gehirn. Pflegekräfte können Bewohnerinnen und Bewohner durch diese intensive Betreuung aktivieren und Erinnerungen wecken. Die alten Menschen sollen dabei möglichst viel selbst machen, etwa den Tisch decken oder ihre Semmeln schmieren. Der therapeutische Mittagstisch unterstützt so nicht nur das Gefühl, zu essen wie früher daheim, sondern bietet zusätzlich einen guten Rahmen für Gespräche mit therapeutischem Hintergrund.
Die Station im Erdgeschoss links ist lichtdurchflutet und hell: Die Böden sind zartgelb, Uhren, wie man sie von alten Bahnhöfen kennt, geben Orientierung, ebenso wie die Pinnwand mit dem Geburtstagskalender. An den Wänden gegenüber vom Stationszimmer, in dem Gabriele S. während der Mittagsruhe mit organisatorischen Aufgaben beschäftigt ist, hängen in bunten Bilderrahmen die Bleistiftzeichnungen einer Künstlerin.
Gabriele S. nimmt gerade einen Stapel Bewohnerakten aus dem Schrank, es ist Zeit für die vom medizinischen Dienst vorgeschriebene Dokumentation. Vielen Pflegekräften gilt sie als notwendiges Übel, das viel zu viel Zeit raubt, doch: „Die Dokumentation ist nicht nur wichtig, um unsere Arbeit festzuhalten und zu sehen, wie die Menschen sich verändern. Sie hat mir auch schon mal den Hals gerettet“, erzählt die Altenpflegerin mit einem sichtlichen Schaudern, als sie sich an den Tag erinnert, an dem plötzlich Kripobeamte vor ihr standen.
Eine Bewohnerin war gestürzt und kurze Zeit später verstorben – und die Tochter der festen Überzeugung, dass das Team seine Fürsorgepflicht verletzt hatte, ihre Mutter an den Folgen des Sturzes gestorben sei. Deshalb hatte sie Anzeige erstattet und die Kripo stand plötzlich vor der Tür. „Da wurde mir ganz heiß, ich bin richtig ins Schwitzen gekommen“, erzählt Gabriele S., während sie durch eine Bewohnerakte blättert. Die lückenlose Dokumentation aber konnte die Vorwürfe vollständig entkräften und beweisen: Es wurden keine freiheitsentziehenden Maßnahmen angeordnet und alle Vorgaben eingehalten, die Dame verstarb aus anderem Grund. Was die ehemalige Unternehmerin noch weiter darin bestärkt hat, dass tadellos geführte Akten und ordentliche Arbeit eine wichtige Grundlage in der Pflege sind.
 In der ganzen Einrichtung finden sich immer wieder Gegenstände, die Orientierung geben sollen, wie zum Beispiel diese nostalgischen Wanduhren. (Foto: Thomas Dashuber/VdPB)
In der ganzen Einrichtung finden sich immer wieder Gegenstände, die Orientierung geben sollen, wie zum Beispiel diese nostalgischen Wanduhren. (Foto: Thomas Dashuber/VdPB)
Im langsamen Gänsemarsch gehen Gabriele S. und fünf Bewohnerinnen den schmalen asphaltierten Weg entlang, der durch den großen Garten des Heims führt. Es ist Zeit für einen Therapiegang. Der führt vorbei an zahlreichen knorrigen Obstbäumen, immer auf einen großen Holzpavillon zu – das Herzstück des großen Außengrundstücks. Die Bäume tragen so viele Äpfel, dass letztes Jahr rund 600 Liter Saft aus den Früchten gepresst werden konnten, berichtet Gabriele S.. „Die letzte Flasche haben wir erst vor ein paar Tagen getrunken“, erzählt sie lachend. Und auch, dass ein Herr, den sie betreut, und der früher Landschaftsgärtner war, so stolz gewesen sei, das ganze Fallobst aufgesammelt zu haben. Weil es ja schade wäre, „wenn sie verkommen“. Danach hätten sie die gesamte Ernte zu einem Bauern in der Nähe gefahren, der daraus dann Saft für die Bewohnerinnen und Bewohner macht.
Gabriele S. fördert die Menschen, sie überlegt sich die verschiedensten Methoden, jedem individuell Freude ins Leben zu bringen und ihn oder sie bei seinen Bedürfnissen zu unterstützen. Ob das jetzt das gemeinsame „Garteln“ in den Hochbeeten ist, an denen sie gerade mit ihrem Grüppchen vorbeigeht, oder gemeinsame Stunden mit einer lokalen Mutter-Kind-Gruppe zu organisieren, damit die alten Menschen mit jungen in Berührung kommen. Die Bewohnerinnen und Bewohner ausschlafen zu lassen, gehört ebenfalls dazu. Freiheit ist für sie mehr als ein abgenutztes Schlagwort. Sie sagt dann einfach gelassen: „Dann hat er halt an einer Aktivität nicht teilgenommen. Die Menschen dürfen Angebote auch ablehnen.“ Und weiß dabei genau, das gibt es nicht überall, weil es nicht gern gesehen ist, wenn jemand aus der Struktur herausfällt. Aber das ist ihr egal: „Hier geht’s um Individuen und die Menschen sollen sich zu Hause fühlen.“
„Rechts, links, rechts, links. Immer einen Fuß vor den anderen.“
Dicke Filzschuhe mit Klett setzen einen kleinen Schritt vor den anderen, der Gang ist noch unsicher, deshalb hält die alte Dame ihren Rollator auch ganz fest. Sie muss nach einem schweren Sturz erst wieder auf die Beine kommen. „Jeder hat ein Recht auf Freiheit, jeder hat ein Recht darauf, zu stürzen“, sagt Gabriele S. immer wieder. Ihre Geduld scheint unendlich, der etwa 50 Meter lange Weg vom Haus bis zur ersten Bank dauert fast eine Viertelstunde. Längst ist der Rest der kleinen Gänseabteilung rechts vorbeigezogen und hat es sich am Pavillon in der Sonne gemütlich gemacht, die Beine auf die Rollatoren hochgelegt.
Endlich lässt sich auch Gabriele S. mit der alten Dame behutsam auf der kleinen Bank neben dem Pavillon nieder. Während sie ihren Blick schweifen lässt, schmiedet sie schon neue Pläne: Sie will junge Seelen mit den alten ihrer Senioren und Seniorinnen zusammenbringen, eine Zusammenarbeit mit dem örtlichen Kindergarten erwirken. Weil die Bewohnerinnen und Bewohner keine Pflege-„Fälle“ sind, sondern so viel zu bieten haben an Erfahrung, an Wissen, an tollen Geschichten und an Lebensweisheit. Und weil die Kinder umgekehrt wie ein Jungbrunnen auf die alten Menschen wirken, sie anregen, unvoreingenommen auf sie zugehen und auch einfach mal spontan ihr Herz ausschütten. Das schafft Nähe – wie in einer richtigen Großfamilie eben. Gabriele S. lächelt die alten Damen neben sich an: „Ich hab hier meine Erfüllung gefunden.“
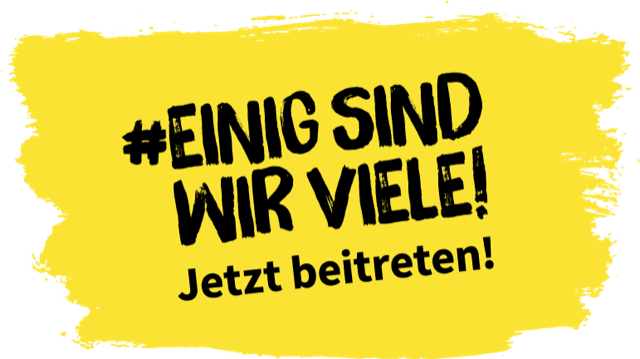
Präsident der VdPB, Krankenpfleger, Lehrer für Pflegeberufe, Leiter einer Pflegeeinrichtung in Altötting
Kinderkrankenpfleger, Stationsleiter Kinderchirurgie
in Augsburg
Vereinigung der Pflegenden in Bayern
Geschäftsstelle
Prinzregentenstraße 24
80538 München
Telefon: 089 54 199 85-0
Fax: 089 54 199 85-99
E-Mail schreiben